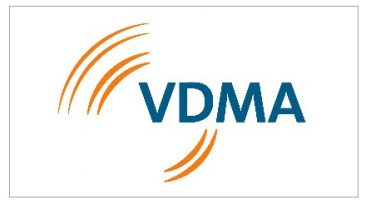Status quo: Sammlung und Verwertung von PET-Flaschen
Die PET-Flasche: Sie wird oft als Musterbeispiel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft genannt. In zahlreichen europäischen Staaten wie Norwegen, Schweden und Finnland wurden bereits Pfandsysteme implementiert, die eine hohe Sammelrate gewährleisten. In Deutschland, wo ein solches System im Jahr 2003 eingeführt wurde, betrug die Recyclingquote von PET-Flaschen vierzehn Jahre später stolze 93%, bei Einweg-Pfandflaschen sogar 97,3%. Von dem daraus gewonnenen Sekundärrohstoff flossen 32,6% in die erneute Herstellung von Getränkeflaschen, 29,4% in die Folienproduktion, 21,8% in die Textilindustrie und 16,2% kamen in sonstigen Anwendungen zum Einsatz [1].
In anderen europäischen Ländern steht einer steigenden Nachfrage nach Recycling-Material eine vergleichsweise geringe Sammelquote gegenüber, weshalb britische Supermarktketten derzeit Pfandsysteme erproben und auch in anderen Staaten wie Frankreich oder Spanien über die Einführung eines solchen Systems diskutiert wird. Bei Vorhandensein von Sammelsystemen in Kombination mit einer hohen Sammelmoral der Bevölkerung ist aber auch ohne Pfand eine beachtliche Sammelrate möglich: In Österreich landen bereits 3 von 4 Flaschen in der gelben Tonne bzw. im gelben Sack [2].
Die Technologien für einen geschlossenen Recycling-Kreislauf sind längst vorhanden: Nach Zerkleinerungs-, Wasch- und Sortierprozessen werden die PET-Flakes in einer Recyclinganlage zu Regranulat verarbeitet und umfassend dekontaminiert (Bild 1+2: Die recoSTAR PET iV+ von Starlinger recycling technology). Die Sparte Starlinger recycling technology des österreichischen Maschinenbauers Starlinger hat weltweit über 55 Bottle-to-Bottle PET-Recyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von >550.000 Tonnen/Jahr installiert. Die Anlagen sind in sieben Größen erhältlich, von einem Durchsatz von 150 bis hin zu 3.600 kg/h. Die Reinigungseffizienz solcher Anlagen erfüllt die strengen Kriterien diverser nationaler Behörden in Bezug auf Lebensmittelkontakt (z.B. EFSA – Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, FDA – US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) sowie die Qualitätsanforderungen namhafter Markeninhaber. Nachdem sie in den letzten Jahren abgeflacht war, boomt die Nachfrage nach PET-Recyclinganlagen wieder. Zur Auslieferung im Geschäftsjahr 2019 kann Starlinger recycling technology bereits Aufträge im Ausmaß einer Jahreskapazität von ~100.000 t vorweisen, was zumindest zum Teil dem Kreislaufwirtschaftspaket der EU zu verdanken ist.
EU-Richtlinien für PET-Recycling
Die EU-Richtlinie 2018/852 vom 30. Mai 2018 unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen verschiedenen Arten von Kunststoffen. Ergo gibt es laut dieser Richtlinie nur eine einzige anzustrebende Recycling-Quote, die für alle Kunststoff-Produkte gleichermaßen gilt; weiters bedeutet dies, dass eine niedrigere Quote in einem Bereich durch eine höhere Quote in einem anderen Bereich ausgeglichen werden kann. Das ambitionierte Ziel: 50% bis Ende 2025, 55% bis Ende 2030 [3]. Im europäischen Mittel müssen die Mitgliedsstaaten ihre allgemeine Kunststoff-Recyclingquote bis 2025 um mindestens 10% steigern [4]. Eine Regelung, die die Verwendung des Regranulats für das ursprüngliche Produkt – im Sinne einer Kreislaufwirtschaft – vorschreibt, suchte man bislang aber vergeblich.
Ebenso fehlten Vorgaben bzw. Quoten, die den Rezyklat-Anteil neuer Produkte regelten. Dieses Versäumnis wird nun in einer Richtlinie zum Umgang mit Einwegplastik (single-use plastics) nachgeholt, die eine Reihe von Kunststoff-Einwegartikeln wie Strohhalme verbietet, für andere Produkte neue Maßnahmen setzt und eine erweiterte Herstellerverantwortung vorsieht. Die neue Richtlinie, deren Umsetzung in nationales Recht durch die EU-Mitgliedsstaaten noch aussteht, legt für Getränkeflaschen einen Mindest-Rezyklat-Einsatz von 25% ab 2025 und 30% ab 2030 fest. Darüber hinaus müssen Verschlüsse und Deckel künftig an den Behältern befestigt werden, um einer Verschmutzung der Umwelt vorzubeugen. Neu ist auch die höhere Sammelquote für Einweg-Kunststoffflaschen: 77% bis 2025 und 90% bis 2029. Während Deutschland diese 90%-Marke bereits geknackt hat, müssen andere EU-Staaten ihre Sammelquote in den nächsten 10 Jahren noch deutlich steigern.
Hindernisse auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft
Für einen zu 100% geschlossenen Kreislauf gilt es noch einige Hindernisse zu überwinden. Als größte Herausforderung sehen Betriebe die Materialverfügbarkeit; um dauerhaft mit Rezyklat zu produzieren, muss die Versorgung in ausreichender Menge und Qualität sichergestellt sein. Dies beginnt bei einem flächendeckenden Sammelsystem, denn alles, was nicht gesammelt wird, kann auch nicht recycelt werden. Auch jenes Material, das zwar gesammelt, aber zu anderen Produkten verarbeitet wird, fällt aus dem Kreislauf. Ein weiteres Hindernis ist die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Recycling-Ware; in der Vergangenheit wurden Rezyklate vielfach als minderwertig abgestempelt. Dieses Image beeinflusst sowohl die Sammelmoral jedes einzelnen als auch die Bereitschaft der Markeninhaber, Recyclingware durch Neuware zu ersetzen. Auf der Seite der Recycler gibt es wiederum technische Limitierungen, zum Beispiel Materialverluste durch das Waschen und Zerkleinern der PET-Flaschen. Ein Beispiel dafür ist PET-Feinabrieb; dabei handelt es sich um 1-3 mm große Partikel, die im Ausmaß von bis zu 5% anfallen. Oft fehlt das Equipment, um auch diesen Feinabrieb zu hochwertigem Material zu verarbeiten, weshalb er häufig für geringwertige Anwendungen eingesetzt wird. Aus diesem Grund hat Starlinger Lösungen zur Verarbeitung von Feinabrieb entwickelt, welche die Besonderheiten dieses Materialstroms berücksichtigen. Möglich ist sowohl die Zudosierung zu PET-Flakes als auch das Recycling auf einer speziell für Feinabrieb konzipierten Anlage.
Vöslauer nimmt Kurs auf die 100%-Marke
Für Vöslauer Mineralwasser im österreichischen Bad Vöslau ist Kreislaufwirtschaft nicht nur ein Modewort, sondern eine Lebenseinstellung. Zwar bestehen Vöslauer PET-Flaschen bereits zu einem Großteil aus “rePET” – so bezeichnet das Unternehmen den gewonnenen Sekundärrohstoff – aber das geht dem Hersteller nicht weit genug: Satte 100% in sämtlichen Flaschen lautet das ehrgeizige Ziel, dessen Umsetzung so rasch wie möglich geplant ist. Wie viele andere Markeninhaber hat Vöslauer bei der EU eine freiwillige Selbstverpflichtung gemeldet, die vorsieht, den Einsatz von rePET in den nächsten Jahren von 3.300 auf 5.500 Tonnen zu steigern. “Unser Anspruch ist, immer besser zu werden, also die Produkte, die Flaschen, die Verpackungen von der Etikette bis zur Trayfolie weiterzuentwickeln – unser Prinzip lautet, jedes Produkt soll nachhaltiger sein als der Vorgänger”, so Geschäftsführerin Birgit Aichinger. “Im letzten Jahrzehnt wurden die Vöslauer Flaschen, Etiketten und Verschlusskappen laufend im Hinblick auf ihre Recyclingfähigkeit optimiert (“Design for Recycling”)”, ergänzt Geschäftsführer Herbert Schlossnikl. Erst im Oktober 2018 machte der Familienbetrieb als Österreichs erstes Unternehmen mit der Einführung der ersten Flasche aus 100% rePET auf dem österreichischen Markt auf sich aufmerksam; in Deutschland wurde bereits Anfang 2019 das gesamte Sortiment (bis auf Vöslauer Balance) auf 100% rePET umgestellt. Dabei legt Vöslauer Wert auf einen gleichbleibenden Materialeinsatz, um das Transportgewicht und damit den CO2-Fußabdruck gering zu halten. Das ganzheitliche Konzept erstreckt sich auf das gesamte Spektrum: Bis spätestens 2025 werden alle Folien und Etiketten aus 100% Recycling-Material bestehen und alle Getränkekisten zu 100% in einen Recycling-Kreislauf kommen.
Das Rezyklat für diese ambitionierten Vorhaben bezieht Vöslauer von der PET to PET Recycling Österreich GmbH im österreichischen Burgenland. Im Vorjahr verarbeitete dieser Recycling-Standort, den Vöslauer gemeinsam mit Coca-Cola, Egger, Rauch und Spitz gegründet hat, rund 25.400 Tonnen PET bzw. eine Milliarde PET-Flaschen [5]. Für das Recycling der gewaschenen und sortierten PET-Flakes betreibt PET to PET seit 2010 eine Starlinger recoSTAR PET 125 HC iV+. Diese Anlage hebt das Molekulargewicht von rPET über ein Polykondensationsverfahren auf das Ursprungsniveau von PET-Neuware; dadurch verliert das Material nicht an Zähigkeit (intrinsische Viskosität) und empfiehlt sich daher für einen zu 100% geschlossenen Recyclingkreislauf. Das Verfahren sorgt außerdem für umfassende Dekontamination des Materials und stellt so die Eignung für Lebensmittelkontakt her. Die einzelnen Prozessschritte der PET to PET Recyclinganlage wie Trocknung, Extrusion, Filtration und Energierückgewinnung werden laufend optimiert, um eine maximale Auslastung zu erzielen. Damit hofft der Betrieb, die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Regranulat besser abdecken zu können. Zusammenfassung Die erfreuliche Nachricht ist, dass PET-Flaschen in vielen Ländern bereits eine sehr hohe Recycling-Quote aufweisen. Die Technologien für die Umsetzung sind vorhanden; nun braucht es ambitionierte Ziele in Kombination mit gesetzlichen Vorgaben für Sammelquote und Rezyklat-Anteil. Vöslauer macht es vor: Für die PET-Flasche ist ein zu 100% geschlossener Kreislauf in greifbarer Nähe.
[1] GVM 2018 “Aufkommen und Verwertung von PET-Getränkeflaschen in Deutschland 2017”
[2] Christoph Scharff, Altstoff Recycling Austria www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170614_OTS0090/3-von-4-pet-flaschen-umweltgerecht-gesammelt-und-recycelt
[3] EU-Richtlinie 2018/852 vom 30.5.2018
[4]Plastics Europe, “Plastics – the Facts 2018” www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf
[5]PET to PET Österreich GmbH www.pet2pet.at/de/news/jahresbilanz-2018-ueber-1-milliarde-pet-flaschen-zu-recyclat-verarbeitet
Quelle: Starlinger