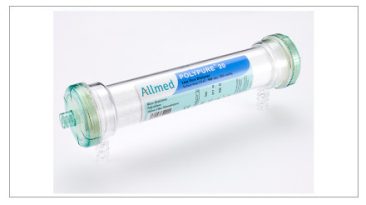Zukunft gestalten statt Mangel verwalten
Die Branche steht vor einer besonderen Herausforderung: Während sie eine zentrale Rolle beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft spielt, kämpft sie gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel – das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) für 2024. Anhand der sogenannten Engpassanalyse der BA kann eine Analyse der Fachkräftesituation für die Berufsgruppe 2210 Kunststoff- und Kautschukherstellung1 erfolgen. Neben der Rückschau auf die Arbeitskräftesituation im vergangenen Jahr wird eine vorsichtige Prognose für 2025 bis 2035 anhand der Daten des europäischen Zentrums für die Entwicklung der Berufsbildung (CEDEFOP) angestellt.
Die Analyse zeigt erhebliche Herausforderungen, eröffnet aber gleichzeitig strategische Handlungsfelder für Unternehmen, die proaktiv agieren.
Rückblick 2024: Kritische Verschärfung der Arbeitskräfteverfügbarkeit
Die Berufsgruppe 2210 Kunststoff- und Kautschukherstellung wird von der BA als Engpassberuf eingestuft. Ein klares Signal für Unternehmen, Politik und Bildungsträger, gezielt in Ausbildung, Weiterbildung und Personalgewinnung zu investieren. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:
• 136 Tage benötigten Unternehmen durchschnittlich zur Stellenbesetzung
• 1,7 Prozent betrug die berufsspezifische Arbeitslosenquote – ein praktisch leergefegter Arbeitsmarkt3
• 2,3 Arbeitsuchende kamen auf jede offene Stelle, was einen intensiven Wettbewerb um verfügbare Fachkräfte verdeutlicht
• 26 Prozent der Beschäftigten sind älter als 55 Jahre
Nachwuchsmangel verschärft Verfügbarkeitssituation
Besonders alarmierend: 16,7 Prozent der gemeldeten Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt – das bedeutet, dass etwa jede sechste Ausbildungsstelle nicht besetzt werden kann. Die BA bewertet diesen Wert mit 2 Punkten und signalisiert damit ein erhöhtes Risiko, dass der Nachwuchsmangel die Engpasssituation künftig erheblich verschärfen könnte.
Die Entwicklungen in den letzten Monaten zeigen jedoch eine leichte Entspannung
Die GKV-Umfrage zur Konjunktur- und Wirtschaftslage 2024/2025 dokumentiert eine moderate Verbesserung der angespannten Personalsituation in der deutschen
Kunststoffindustrie: Der Anteil der Unternehmen mit Fachkräfteengpass sank von 72 Prozent im Vorjahr auf 66 Prozent in 2025. Diese Entspannung ist jedoch nur oberflächlich, denn
strukturelle Probleme bleiben bestehen – so stellt die Personalsuche nach wie vor für 58 Prozent der Kunststoffverpackungshersteller eine große Herausforderung dar, wie die 49. KI-
Konjunkturumfrage bestätigt.
Die Ursachen für diese ambivalente Entwicklung liegen in zwei gegensätzlichen Marktdynamiken: Einerseits hat der Stellenabbau 2024 das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt leicht entspannt. Andererseits schwächt die anhaltend angespannte Lage der deutschen Industrie die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften – ein Umstand, der sich in der zurückhaltenden Personalpolitik widerspiegelt: Die Mehrheit der kunststoffverarbeitenden Unternehmen plant für die zweite Jahreshälfte 2025 keine Personalveränderungen. Besonders kritisch zeigt sich die Situation bei spezifischen Berufsgruppen.
Die GKV-Umfrage identifiziert zwei Top-Engpassberufe für 2025:
• Kunststofftechniker/-technologen: 79 Prozent der Unternehmen verzeichnen hier einen Mangel
• Auszubildende im technischen Bereich: 65 Prozent der Unternehmen geben hier einen Engpass an
Langfristprognose zeigt Herausforderung
Die aktuellen CEDEFOP-Prognosen bis 2035 verdeutlichen die komplexe Situation in Deutschland in der Branche „Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren“: Während aufgrund des demografischen Wandels etwa 1,1 Millionen neue Stellen für Anlagen- und Maschinenbediener entstehen werden, schrumpft gleichzeitig die Beschäftigung in diesem Berufsbereich um -0,6 Prozent jährlich – ein Rückgang von 64.301 Arbeitskräften.
Die Zahlen offenbaren eine besorgniserregende Entwicklung: Während der Bereich „Anlagen- und Maschinenbediener“ EU-weit um 0,1 Prozent wächst und die Branche „Herstellung von
Gummi- und Kunststoffwaren“ europaweit jährlich Zuwächse von 0,2 Prozent verzeichnet, wird für Deutschland einen Rückgang von 0,5 Prozent pro Jahr prognostiziert. Diese Diskrepanz
ist hauptsächlich auf strukturelle Nachteile am Standort Deutschland zurückzuführen. Auch im Bereich „Wissenschaft und Engineering“ – der mechanische, chemische und
umwelttechnische Ingenieure umfasst – zeigt sich Deutschlands unterdurchschnittliche Position. Während EU-weit jährlich 1,7 Prozent neue Arbeitsplätze bis 2035 entstehen, erreicht
Deutschland nur 0,7 Prozent Wachstum pro Jahr, was absolut 134.566 Personen entspricht.
Die Branche steht damit vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits muss sie den massiven Ersatzbedarf durch altersbedingte Abgänge decken, andererseits erfordert die strukturelle Schrumpfung eine strategische Neuausrichtung hin zu höherer Produktivität und technologischer Modernisierung.
Europäische Wachstumsregionen als Chance
Während Deutschland schrumpft, entwickeln andere EU-Länder ein erhebliches Arbeitskräftepotenzial im Bereich „Anlagen- und Maschinenbediener“. Spitzenreiter sind Zypern mit einem jährlichen Beschäftigungswachstum von 4,5 Prozent bis 2035 und Irland mit 3,4 Prozent Zuwachs. Weitere relevante Länder für die künftige Arbeitskräfteakquise sind Malta, Portugal, Rumänien, die Slowakei und Spanien. Deutlich bessere Perspektiven im Berufsbereich „Wissenschaft und Engineering“ bieten Malta mit 5,6 Prozent Wachstum pro Jahr und Österreich mit 3,2 Prozent jährlichem Zuwachs bis 2035. Über zwei Prozent jährlichen Arbeitskräftezuwachs in diesem Segment erwarten auch Kroatien, Tschechien, Estland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Polen, die Slowakei, Slowenien und die Türkei.
Angesichts der demografischen Entwicklungen und des prognostizierten Arbeitskräftewachstums sollten deutsche Branchenunternehmen gezielt Rekrutierungsstrategien in den wachstumsstarken EU-Ländern entwickeln.
Unternehmen reagieren bereits jetzt
Die demografische Entwicklung sowie der fortschreitende technologische Wandel und der Fachkräftemangel fordern Unternehmen dazu auf, den Wissenstransfer und die Nachfolgeplanung systematisch anzugehen. Digitale Werkzeuge und Automatisierung ermöglichen es, Arbeitsplätze effizienter zu gestalten und den Ersatz ausscheidender Mitarbeitender bedarfsgerecht anzupassen11. Ein hohes Substituierbarkeitspotenzial erlaubt es, Mitarbeitende gezielt weiterzubilden, etwa durch maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme, modulare Lernformate und Mentoring, um sie für vielfältige Tätigkeiten zu qualifizieren.
Gleichzeitig adressieren Unternehmen den Fachkräftemangel durch attraktivere Vergütung (Medianentgelte stiegen um 10,8 % zwischen 2020 und 2023),
verstärkte internationale Rekrutierung (+ 3,2 % ausländische Beschäftigte) und innovative Personalgewinnung, etwa über digitale Plattformen (72 % setzen neue Recruiting-Kanäle
ein). Moderne Führung, flexible Arbeitsmodelle und Engagement für Nachhaltigkeit werden zunehmend zu Differenzierungsmerkmalen im Wettbewerb um Talente. Damit schaffen
Unternehmen nicht nur Voraussetzungen für Innovation und kulturelle Vielfalt, sondern auch ein attraktives Arbeitsumfeld, das insbesondere für jüngere Fachkräfte entscheidend ist.
Die Nachwuchsförderung ist ein zentrales Thema für die Zukunft der Branche und spielt auch auf der K 2025 eine große Rolle. So unterstützt die Young Talents-Lounge am GKV-Stand junge Talente bei der Berufsorientierung: Experten geben Infos zu spannenden Ausbildungswegen, Studienmöglichkeiten und nachhaltigen Karrierechancen in der Kunststoffindustrie. Die Kunststoffverpackungsbranche steht vor großen Veränderungen. Um diese zu meistern, braucht es mutige Nachwuchskräfte, die bereit sind, neue Wege zu gehen und den Wandel hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft konsequent vorantreiben.
Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen bringt mit ihrer Veranstaltung NextGen Plastics am 18. Juni 2026 in Düsseldorf die Menschen zusammen, die die Zukunft der Kunststoffverpackungsbranche maßgeblich prägen werden: junge Vordenkerinnen und Vordenker, die Verpackungen nachhaltig denken und
mutig und engagiert weiterentwickeln. Der Austausch auf Augenhöhe und die Vernetzung unter Gleichgesinnten in der Branche sollen dabei gezielt gefördert werden.