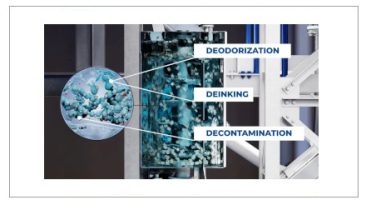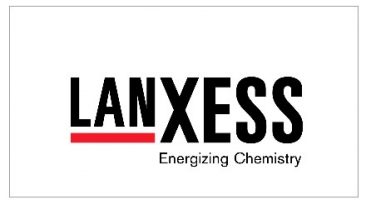SKZ und Uni Bayreuth forschen an additiv gefertigten, biobasierten WPC-Grünköpern
Der Lehrstuhl Keramische Werkstoffe der Universität Bayreuth untersucht in Kooperation mit dem SKZ einen kostengünstigen und nachhaltigen Weg, SiSiC-Keramiken herzustellen. Das innovative Forschungsprojekt analysiert hierfür die Umwandlung von additiv gefertigten WPC-Grünkörpern zu hochwertigen Keramiken.
Anwendungen unter extremen Bedingungen, wie Temperaturen über 800 °C bei gleichzeitiger Abrasion und korrosiver Atmosphäre, sind nur mit technischen Keramiken möglich. Die wichtigste Nicht-Oxidkeramik stellt Siliziumkarbid (SiC) dar. Dieser Hochleistungswerkstoff kann über das Schmelzinfiltrationsverfahren als siliziuminfiltriertes Siliziumkarbid (SiSiC) hergestellt werden. Konventionell werden Pressverfahren zur Formgebung verwendet. Dieser Prozess der Grünkörperfertigung führt auf Grund des sehr harten SiC-Pulvers jedoch zu einem hohen Werkzeugverschleiß und ist darüber hinaus in der geometrischen Auslegung limitiert.
In einem jüngst gestarteten Forschungsprojekt der Uni Bayreuth und des SKZ wird eine neuartige Prozessroute untersucht, Keramiken kosteneffizienter, nachhaltiger und mit höherer Geometriefreiheit herzustellen. Die Besonderheit im gewählten Ansatz liegt darin, dass ein thermoplastisch verarbeitbares Material zur Grünkörperfertigung genutzt wird. Jalena Best, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Keramische Werkstoffe an der Universität Bayreuth, erklärt: „Zuerst wird der Grünkörper aus WPC-Granulat (Wood Polymer Composite) gefertigt. Dieser wird bei Temperaturen über 1000 °C in Stickstoff pyrolysiert, sodass ein Körper aus reinem Kohlenstoff entsteht. Dabei ist es für das Endprodukt wichtig, dass der Kohlenstoffkörper möglichst formstabil und blasenfrei ist. Abschließend wird der Kohlenstoffkörper mit flüssigem Silizium infiltriert. Bei diesem Prozessschritt reagiert das Silizium mit dem Kohlenstoff zu Siliziumkarbid, wodurch sich eine SiSiC-Keramik ausbildet.“ Im Rahmen zweier früherer Forschungsprojekte konnte bereits die Machbarkeit dieser Prozessroute eindrucksvoll demonstriert werden. Im jetzt gestarteten Projekt sollen die Anwendungsmöglichkeiten erweitert werden.
„Das Forschungsvorhaben leistet einen Beitrag zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele, indem auf Grund dieser innovativen Herstellungsroute Ressourcen und Energie eingespart werden“, hebt Professor Schafföner, Inhaber des Lehrstuhls Keramische Werkstoffe, hervor. „Zudem ist die Kombination aus additiver Fertigung, holzbasiertem Thermoplastcompound und dem Ziel, eine biogene SiSiC-Keramik konturnah herzustellen, neuartig und wirtschaftlich attraktiv“, fügt Professor Schafföner hinzu.
Endkonturnahe Fertigung mittels additiver Fertigung
„Ziel des neuen Projektes ist es nun, das mit Holz hochgefüllte Material mittels additiver Fertigung zu verarbeiten.“ erklärt Moritz Grünewald, Scientist in der Gruppe der Materialentwicklung am SKZ. „Um das Materialcompound auf den 3D-Druckern verarbeiten zu können, muss dieses spezielle Eigenschaften aufweisen“, so Grünewald weiter. Die additive Fertigung ermöglicht die endkonturnahe Fertigung und somit ein Minimum an notwendiger Nachbearbeitung des harten Materials. Außerdem können durch den 3D-Druck ganz neue Funktionsintegrationen, wie gradierte Bauteile, erhalten werden, wodurch neuartige Anwendungen realisierbar sind. Die additive Formgebung soll mittels zweier Verfahren untersucht werden: das Fused Deposition Modelling (FDM) und die Fused Granular Fabrication (FGF). Beide Methoden zeichnen sich durch verhältnismäßig geringe Gerätekosten aus und erlauben es somit Firmen, die Technologie mit geringen Anschaffungskosten zu übernehmen. Interessierte Firmen sind gerne dazu aufgerufen, sich mit im projektbegleitenden Ausschuss zu beteiligen und detailliertere Informationen zum Projekt zu erhalten.
Das Projekt » 3D-Druck von WPC zur Herstellung endkonturnaher komplexer SiSiC-Bauteile« 22307 N der Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum e.V. FSKZ wird über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Lehrstuhl Keramische Werkstoffe der Universität Bayreuth
Der Lehrstuhl Keramische Werkstoffe der Universität Bayreuth beschäftigt sich mit anwendungsorientierter Grundlagenforschung auf dem Gebiet der keramischen Struktur- und Funktionswerkstoffe. Dabei werden die erforschten Themengebiete von der Charakterisierung von Material- und Bauteileigenschaften bis hin zur Anwendung bei Industriepartnern bearbeitet. Die Entwicklung neuer, energie- und ressourceneffizienter Materialien und Prozesse sowie die Schließung von Stoffkreisläufen stehen dabei im Vordergrund.
Das Kunststoff-Zentrum SKZ
Als Europas größtes Kunststoff-Institut bietet das SKZ seit 61 Jahren praxisgerechte Lösungen für die Kunststoff-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Neben Forschung und Entwicklung mit direktem Praxisbezug bietet das SKZ Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen zur Qualitätssicherung von Werkstoffen und Fertigprodukten, Kongresse und Tagungen zur Weiterbildung von Fach- und Führungskräften, Praxisseminare und Lehrgänge zur Qualifizierung von Praktikern sowie Zertifizierungen von Managementsystemen z. B. nach ISO 9001. Getragen wird das SKZ von einem leistungsstarken Netzwerk mit mehr als 400 Unternehmen.