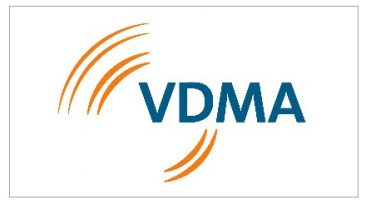Additive Manufacturing (AM) wird inzwischen häufig in den Branchen Dental, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie dem Prototypen- und Leichtbau eingesetzt. Meist jedoch aber im reinen Prototyping oder für Kleinstserien. Aber in herkömmlichen Spritzguss-Werkzeugen wird der Metall-3D-Druck verstärkt Einsatz finden, wie es sich in den letzten Jahren abzeichnet.
Die Wärme, die beim Spritzguss im Werkzeug entsteht, kann nützlich, aber auch schädlich sein. Deshalb versehen die Werkzeug- und Formenbauer ihre Formen mit Kühlkanälen, um die Temperatur entsprechend besser kontrollieren zu können. Jedoch kommen subtraktive Fertigungsverfahren wie beispielsweise das Fräsen bei der Fertigung von sogenannten konturnahen Kühlkanälen an ihre Grenzen. Konturnahe Kühlkanäle werden seit Jahren von vielen Werkzeugbauern verbaut, erläutert Prof. Steffen Ritter von der HS Reutlingen. Oftmals ist die den komplexer werdenden Bauteil-Strukturen geschuldet. Hier könnte in Zukunft der Metall-3D-Druck seine Vorteile ausspielen.
Metall-Verfahren etabliert sich im Tooling
Noch bewegt sich in der industriellen Fertigung das Additive Manufacturing auf einem geringen Level. Aber die Anzahl der wirtschaftlich relevanten Anwendungen im Werkzeugbau wächst stetig, wie eine Studie des VDMA aus dem Frühjahr 2018 bestätigt. Von den 3.250 befragten Mitgliedsunternehmen hatten lediglich ein Fünftel der Umfrage zufolge gar keinen Kontakt mit AM. Mehr als die Hälfte aller Anwendungen waren im Bereich der funktionalen Prototypen und der Rest in der Produktion von Kleinserien und Ersatzteilen. „Die Vorteile wie höchste Konstruktionsfreiheit, designgesteuerte Fertigung und ein schnellerer Herstellprozess überzeugen immer mehr. Wir können heute sagen, dass sich additive Technologien, insbesondere die pulverbettbasierten Metall-Verfahren, im Tooling etabliert haben. Das trifft vor allem auf die Herstellung von Spritzgusswerkzeugen zu. Allerdings gibt es generell noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten, um erprobte Verfahren und Materialien weiter zu optimieren, um neue Technologien und Werkstoffe zu identifizieren, Prozessparameter anzupassen sowie neue oder erweiterte Anwendungen zu finden. Ein wesentliches Ziel ist die stärkere Automatisierung und Industrialisierung der Prozesse“, sagt Dietmar Frank, Regional Director Central Europe bei EOS, einem der international führenden Technologieanbieter für den industriellen 3D-Druck. Und diesen Weg möchte auch Siemens beschreiten, wie Helmut Zeyn, Direktor bei der Siemens Industry Software GmbH, bestätigt und Beispiele aufzeigt, wie mittels industrialisierter additiver Fertigung effizientere Spritzgusswerkzeuge hergestellt werden können. Der Werkzeugbau mit abtragenden oder umformenden Technologien, wie zum Beispiel Fräsen oder CNC-Drehen unterliegt verfahrensbedingten Einschränkungen. So können die Kühlkanäle beim Spritzguss-Werkzeug mittels Fräsen beispielsweise nur gerade ausgeführt werden. Je komplexer also die Geometrie eines Bauteils ist, desto schwieriger wird es, die Kühlung präzise entlang der Kontur des Werkzeugs zu führen. Deshalb wird die konventionelle Fertigung anspruchsvoller Bauteile zeit- und kostenintensiv. Da sich zudem eine ungleichmäßige Kühlung des Werkzeugs negativ auf die Teilequalität auswirkt, erhöht sich der Ausschuss. Sogenannte „Hot Spots“ sind hierfür häufig die Ursache für unerwünschte Verformungen. Der schichtweise Aufbau im Additive Manufacturing ermöglicht Konstrukteuren, Kanäle zur Kühlung optimal an die Werkzeugform anzupassen und diese in gleichmäßigen Abständen zur Bauteiloberfläche zu integrieren. Auf diese Weise kann im gesamten Werkzeug eine äußerst homogene Oberflächentemperatur erzeugt werden, wodurch sich die Wärmeabfuhr deutlich verbessert. Im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren bietet die industrialisierte additive Fertigung eine deutliche Zeitersparnis und formunabhängige Wirtschaftlichkeit. „Da im 3D-Druck jedes Bauteil direkt aus CAD-Daten gefertigt wird, werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Das spart Arbeitsaufwand und verringert das Fehlerrisiko in der Herstellung,“ erklärt Zeyn.
So hat beispielsweise Volkswagen in Wolfsburg ein neues, hochmodernes 3D-Druck-Zentrum eröffnet. Mit einer neuen Drucker-Generation möchte der Werkzeugbau von Volkswagen zukünftig in die 3D-Serienproduktion gehen. „Das 3D-Druck-Zentrum hebt die Additive Fertigung von Volkswagen auf ein neues Niveau“, sagte Andreas Tostmann, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, bei der Eröffnung des 3D-Druck-Zentrums. „Der dreidimensionale Druck wird in zwei bis drei Jahren auch für erste Teile in der Serienfertigung interessant. Perspektivisch können wir 3D-Drucker auch direkt an den Fertigungsstraßen innerhalb der Fahrzeugproduktion einsetzen,“ so Tostmann weiter. Derzeit werden im Werkzeugbau in Wolfsburg vor allem noch Prototypen und Werkzeuge gebaut. Seit fünf Jahren wird auch schon bei Audi 3D-gedruckt. So verlässt jeden Tag mindestens ein Hilfswerkzeug das 3D-Druckcenter. Mit den gedruckten Positionierungshilfen, Sicherungsvorrichtungen oder Gussformen unterstützt das 3D-Druckteam die Kollegen in der Produktion. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Volkswagen-Konzern ein weltweites 3D-Druck-Netzwerk aufbauen möchte, das Mitarbeiter standortübergreifend mit gedruckten Innovationen unterstützt.
Die Automobilindustrie die meist als Vorreiter vieler Innovationen gilt, wird damit sicherlich den Grundstein für die nächste Stufe der Additive Manufacturing (AM) unter dem Stichwort Industrie 4.0 legen.
Im Detail – Wachstumsmarkt 3D-Druck
Der weltweite Markt für 3D-Druck-Industrieprodukte wird laut einer Strategy&-Studie der PwC Strategy& (Germany) GmbH in Kooperation mit dem 3D-Druck-Spezialisten Materialise, pro Jahr zwischen 13 und 23 Prozent steigen und 2030 ein Volumen von 22,6 Milliarden Euro erreichen. In der Automobilindustrie soll das Marktvolumen von 0,34 Mrd. Euro (2015) auf 2,61 Mrd. Euro (2030) wachsen, was einem Anstieg um 15 Prozent entspricht.
Innerhalb der Luft- und Raumfahrtindustrie prognostizieren die Experten bis 2030 ein 3D-Druck-Marktvolumen von weltweit 9,59 Mrd. Euro. In der Medizintechnik wird das 3D-Druck-Marktvolumen von 0,26 Mrd. Euro (Stand: 2015) auf 5,59 Mrd. Euro (2030) steigen. In der Automobilbranche wächst das 3D-Druck-Marktvolumen den Schätzungen zufolge von 0,34 Mrd. Euro (2015) auf 2,61 Mrd. Euro (2030).
Quelle: Hanser Verlag