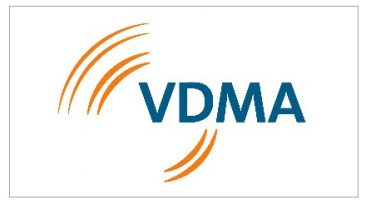Mobilitätstrends wie die E-Mobilität und sogar das Autonome Fahren werden die Anwendungsgebiete der Kunststoffe neu definieren, denn eine Vielzahl neuer Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch Funktionen der zu verbauenden Komponenten erfordern neue angepasste Werkstoffe. So wird beispielsweise die Integration von Sensoren, Batterien und E-Motoren die Ingenieure vor neue komplexe Herausforderungen stellen.
Das Beratungsunternehmen Strategy Analytics hat sich mit dem Markt für elektrifizierte Fahrzeuge auseinandergesetzt und erwartet in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen. Die konservativ geschätzte Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2025 gut 27 Mio. elektrifizierte Fahrzeuge von den Produktionsbändern laufen sollen, was etwa einem Viertel der weltweiten Neufahrzeug-Produktion entspricht. Etwa sieben Mio. sollen reine Elektroautos sein. Aber mehr als die Hälfte dürfte der Analyse zufolge in China produziert werden. Acht Mio. Fahrzeuge sollen 2025 mit einem Mildhybrid gebaut werden, fast ausschließlich mit 48-V-Technik. Für die Zeit nach 2025 erwartet das Beratungsunternehmen den Eintritt in „eine zweite Wachstumsphase“, da dann langsam die ersten Verkaufsverbote für Verbrenner-Neuwagen in Kraft treten, etwa in Norwegen (2025), China, Island, Israel, Indien, Irland sowie in den Niederlanden (2030) oder ab 2040 in Frankreich, Großbritannien, Taiwan sowie im US-Bundesstaat Kalifornien.
Die Automobilhersteller müssen zukünftig eine Palette unterschiedlicher Angebote anbieten.
- Mildhybride Fahrzeuge Strategy Analytics definiert diese Gruppe als Fahrzeuge, die zur Drehmomentsteigerung einen Elektromotor mit weniger als 15 kW haben.
- Vollhybride Fahrzeuge Nach Ansicht von Strategy Analytics konzentrieren sich die meisten Automobilhersteller auf kostengünstige 48-V-Mildhybride und Plug-in-Hybride. Vollhybriden Fahrzeugen wie etwa der Toyota Prius wird eine eher moderate Nachfrage prognostiziert.
- Plug-in-Hybride Fahrzeuge, die im reinen Elektrobetrieb gefahren und an öffentlichen Ladestationen oder in der heimischen Garage aufgeladen werden können, werden in den kommenden Jahren stark nachgefragt.
- Batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge (BEVs) werden ähnliche Zuwachsraten aufweisen wie die Plug-in-Modelle.
- Brennstoffzellen-Fahrzeuge (FCEV) werden nach Ansicht von Strategy Analytics eine hochpreisige Nische im Automobilmarkt – speziell auf dem Leichtfahrzeug-Sektor bilden, können aber langfristig die richtige Ergänzung zu batterieelektrischen Antriebssträngen sein.
(Quelle: All-Electronics – Marktprognose Elektromobilität 2025 und danach)
Leichtbau ist das A und O bei der E-Mobilität
Das Ziel des Projekts ProLemo (Produktionstechnologien für effiziente Leichtbaumotoren für Elektrofahrzeuge) war es, Elektromotoren mit Hilfe von Kunststoffen leichter und damit effizienter zu machen. Existierende Elektromotoren sind noch immer zu schwer, zu groß und zu teuer. Um sie dennoch für den Massenmarkt Elektromobilität einsetzen zu können, wurden im Projekt ProLemo innovative Serienfertigungs- und Leichtbautechnologien entwickelt. Dabei war ein wichtiger Aspekt das Reduzieren des Motorgewichts. Die Verbundpartner waren WITTENSTEIN cyber motor GmbH, ARBURG GmbH + Co KG, INDEX-Werke GmbH & Co. KG, Hahn & Tessky, Aumann GmbH und das Karlsruher Instituts für Technologie mit den Instituten wbk Institut für Produktionstechnik und FAST (Institut für Fahrzeugsystemtechnik).
Im Projekt wurde unteranderem die Entwicklung eines Schleuderverfahrens zur Herstellung von CFK-Stahl-Hybridwellen vorangetrieben. Als Alternative zu Stanz- und Paketierprozessen von Elektroblech entwickelten die Projektpartner die Möglichkeit der Herstellung von Rotorscheiben aus Soft MagneticCompound. Auch die Weiterentwicklung einer flexiblen und automatisierten Herstellung einer komplexen Statorwicklung zur Erhöhung des Kupferfüllgrade stand ebenso auf der Agenda, wie die Entwicklung eines Verfahrens zur unwuchtminimalen Montage von Rotorkomponenten. Zudem realisierte man eine Produktionskette im Produktions-technischen Labor E-Antriebe des wbk Instituts für Produktionstechnik.
Quelle: Kuteno