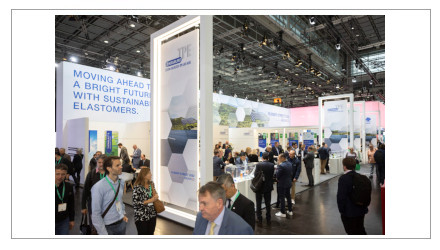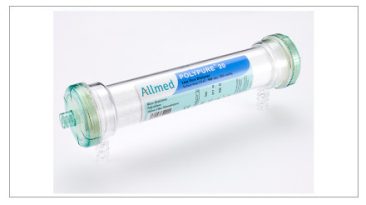Die K in Düsseldorf ist nicht nur die weltweit wichtigste Fachmesse der Kunststoff-, sondern auch der Kautschukindustrie. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind aber auch hier brennende Themen, an denen keiner vorbekommt. Ein Grund mehr, im Vorfeld der K 2025 einmal zu beleuchten, wie wichtig Kautschuk in „grünen“ Einsatzgebieten ist.
von Dr. Stefan Albus
Unsere Gesellschaft steht durch den Klimawandel vor ganz neuen Herausforderungen. Spielt der Werkstoff Gummi, immerhin vor über 180 Jahren erfunden, hier immer noch eine Rolle?
Geothermie
Logisch! Oft braucht man dafür sogar Gummiwerkstoffe aus besonders hochentwickelten Synthesekautschuken. Ein Beispiel für derartige Einsatzgebiete, ist die Wärmegewinnung aus tieferen Erdschichten. Denn Geothermie-Bohrungen können durchaus Tiefen von 1.000 bis sogar 3.000 Metern erreichen. Hierbei kommen unter anderem sogenannte Packer zum Einsatz, etwa einen Meter lange Manschetten, die einen Abschnitt des Bohrlochs abdichten können; diese bestehen unter anderem aus hitzebeständigem Gummi. In den damit isolierten Bereichen kann man zum Beispiel Temperatur- oder Druckmessungen vornehmen.
Übrigens werden in derartigen Tiefbohrungen – in Geothermie-Projekten, aber durchaus auch im Erdölsektor – gerne auch Motoren mit einem wendelförmigen Rotor in einem innen mit Gummi ausgekleidetem Statorgehäuse eingesetzt. Als Gummi-Komponente kommt hier das halbe Who’s Who der fortgeschrittenen Gummi-Anwendungstechnik zum Einsatz: Nitrilkautschuk (NBR), NBR-HR („High Resistance“-NBR), Hydrierter Nitrilkautschuk (HNBR) und sogar extrem chemikalienbeständige Fluorelastomere, je nach Temperaturprofil und Aggressivität der Spülflüssigkeiten.
Apropos Tiefenbohrung: Auch Erdgas gilt für eine Übergangszeit noch als Brennstoff für eine vergleichsweise CO2-arme Energieproduktion. Aktuell bezieht Deutschland viel Erdgas aus den USA, wo rund 88 % dieses Energieträgers durch Fracking gewonnen werden.
Hierfür werden unter anderem extrem leistungsfähige Schläuche benötigt, die auch dem Kontakt mit aggressiven Flüssigkeiten standhalten können, die in das Gestein eingetragen werden, um das dort verteilte Gas auszutreiben. Hier werden gerne mehrschichtige Produkte eingesetzt, deren innere Schicht aus einem säurebeständigem Synthesekautschuk besteht; für die äußere Schicht werden Gummisorten mit ausgezeichneter Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit eingesetzt.
Eine gefürchtete Gefahrenquelle bei der Erdgas-Förderung sind übrigens unkontrollierte, heftige Gas-Freisetzungen aus den Lagerstätten, „Blowout“ genannt. Diese unterbindet man mit Hilfe sogenannter „Blowout-Preventer“ (BOPs), also extrem belastbarer Dichtungen aus Gummi – die auch den Kontakt mit Schwefelwasserstoff und korrosiven sowie abrasiven Medien überstehen. Diese Dichtungen sind sehr teuer und sollten entsprechend lange halten. Hier greift man gerne zu HNBR.
Biogas und Wasserstoff
Im Jahr 2021 wurden rund neun Prozent der gesamten Landwirtschaftsfläche Deutschlands für die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen für die Biogasproduktion genutzt.
Nun enthält Biogas nicht nur den Brennstoff Methan, sondern auch korrosive Bestandteile wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Daher kommen in Biogasanlagen unter anderem EPDM-Membranen („gesättigter Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk“) zum Einsatz, die allerdings mit Doppelmembranen aus PVC-beschichteten Polyestergeweben konkurrieren. Beide Werkstoffe haben in dieser Anwendung ihre Vor- und Nachteile; EPDM-Gummi ist aber etwas flexibler und lässt sich gut recyceln.
Waren die bisher geschilderten Aufgaben für hochentwickelte Gummiwerkstoffe noch halbwegs „klassisch“ zu lösen, wird’s beim Wasserstoff richtig schwierig. Wasserstoff verflüssigt sich unter Normaldruck erst bei ausgesprochen tiefen Temperaturen; daher sollten die Dichtungswerkstoffe für eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft für ein breites Temperatur-Spektrum (Minus 40 bis über 80°C) ausgelegt sein. Außerdem gilt es, hohen Drücken standzuhalten.
Das Problem: Unpolare H2-Moleküle können durch übliche Dichtungswerkstoffe diffundieren und diese beeinträchtigen. Lagert sich Wasserstoff nach und nach in das Dichtungsmaterial ein, kann es sogar zu explosiven Dekompressionen kommen, die die Dichtung zerstören. Dabei werden diese in der Wasserstoffwirtschaft dringend benötigt: für die Elektrolyse, in Ventilen oder Membranen, für den Transport in Tanks und Leitungen und natürlich in Brennstoffzellen.
Tatsächlich sind wirklich effektiv H2-feste Gummidichtungen noch Gegenstand aktueller Forschung; möglicherweise lässt sich hier durch eine kluge Kombination aus gasdichten Gummisorten und Füllstoffen, die die Wasserstoff-Quellung und Permeation behindern, einiges erreichen. Als Basiselastomere kommen – bereits von Haus aus relativ gasdichter – Butylkautschuk oder auch Fluorkautschuke in Frage; plättchenförmige Additive wie Schichtsilikate oder Graphit können den Gasdurchtritt weiter verringern helfen.
Um den Transport des Wasserstoffs zu vereinfachen, sind neuerdings auch alternative Trägermedien in der Diskussion, zum Beispiel das bei Raumtemperatur gasförmige Ammoniak, NH3, das sich leichter verflüssigen und lagern lässt. Hier braucht es ebenfalls tieftemperatur-, aber auch besonders basenbeständige Hochleistungskautschuke.
Natürlich verrichtet Wasserstoff in Brennstoffzellen bereits sehr zuverlässig seinen Dienst. „Den“ Dichtungswerkstoff gibt es dafür allerdings nicht. Denn es gibt nicht „die“ Brennstoffzelle: Man kennt zum Beispiel alkalische- und Phosphorsäure-, Polymerelektrolyt- und Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Allerdings werden auch hier bereits Elastomer-gebundene Dichtungsmaterialien mit einem hohen Gehalt an speziellen Füllstoffen für Dichtaufgaben herangezogen.
Windkraft
Windkraft-Anlagen wachsen in immer größere Höhen: Sie können heute mit Rotorendurchmessern von 150 bis über 220 m durchaus Nennleistungen bis über 10 MW erreichen. Dabei stellen, vor allem Offshore, UV-Strahlung, Ozon (im Umfeld elektrischer Anlagen ohnehin kein seltener Gast), Salzwasser und stark schwankende Temperaturen hohe Anforderungen an die hier eingesetzten elastischen Materialien. Obendrein sind natürlich beste Flammschutzeigenschaften gefragt, denn einmal in Brand geratene Gondeln sind praktisch nicht mehr zu löschen.
In diesen Gondeln braucht es zum Beispiel Bauteile zur Schwingungsentkopplung und elastischen Lagerung des Generators: Gummipuffer sind etwa an den Verbindungen zwischen den Rotorblättern und der Nabe zuhause. Dort absorbieren sie Kräfte und Schwingungen und helfen, Vibrationen zu minimieren und auch, Geräusche zu dämpfen.
Naturkautschuk wird man unter den etlichen hundert Kilo elastomerer Materialien, die in Windkraftanlagen verbaut werden, schon auf Grund seiner problematischen Witterungs- und Ozonbeständigkeit kaum finden. Für Vollgummi-Rotationswellen zieht man gerne NBR-Gummi heran. In Radial-Wellendichtringen etwa findet man oft auch ozonbeständigen HNBR-Kautschuk, der kurzzeitig obendrein Temperaturen bis 170 °C übersteht. Mit entsprechender Armierung ist dieser auch in Lagern mit großem Durchmesser einsetzbar, auf Grund seiner Ölbeständigkeit sogar in fettgeschmierten Hauptlagern.
Kabel, die den Strom aus Offshore-Windkraftanlagen transportieren, können sehr heiß werden. Hier braucht es Gummi-Werkstoffe mit höherer Temperaturbeständigkeit, außer aus HNBR zum Beispiel aus EPDM. Und, nicht zu vergessen: Gummi ist nicht erst im Einsatz dieser Anlagen gefragt. Schon bei der Fertigung der Rotoren aus GFK-Elementen werden Profile aus Silikon-, Butyl- oder EPDM-Kautschuk benötigt.
Solaranlagen
Auch für Solaranlagen braucht man natürlich Dichtungen, die die Module in Position halten und dafür sorgen, dass kein Regen eindringen kann. Vertikaldichtungen, die mehrere Photovoltaik-Module auf Distanz halten, bestehen zum Beispiel aus Silikonkautschuk oder witterungsbeständigem EPDM.
Zentrale Dichtungsaufgaben übernimmt aber meist ein anderer Werkstoff. So werden Solarmodule oft in Ethylen-Vinylacetat-Folien (EVA) eingekapselt. Dabei schließt man die Solarmodule in zwei Schichten aus diesem Werkstoff ein; schmilzt die Folie, umschließt sie die Zellen perfekt. EVA ist ausgesprochen lichtdurchlässig und witterungsbeständig und weist ein breites Verarbeitungsfenster auf; es ist zwar kein klassisches Elastomer, darf aber, je nach Vinylacetat-Anteil, durchaus als „elastomerähnliches“ Material verstanden werden. Es gibt mittlerweile auch Ansätze, EVA-Folien aus fossilen Quellen durch Varianten mit einem hohen Prozentsatz aus biobasiertem »Zuckerrohr-Ethylen« zu ersetzen.
Und damit die schicken Solarpanele auf schicken Flachdächern nicht verrutschen, greifen Monteure gerne zu Matten aus EPDM: Sie bieten zusätzlichen Halt auf rutschigen Oberflächen und verhindern, dass sich die Module mit der Zeit verschieben.
Und wo wir gerade bei Gebäuden sind: Natürlich kommen auch Wärmepumpen kaum ohne Gummi aus. Hier sind allerdings eher (witterungsbeständige) Dichtungen und Schläuche gefragt, die auch bei tieferen Temperaturen eine ausreichende Flexibilität aufweisen, aber auch schwingungsdämpfende Gummimatten, die unerwünschte Vibrationen der Geräte verringern. Gummi ist also alles andere als ein „veralteter“ Werkstoff. Ohne extrem leistungsfähige Gummitypen würden Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel nicht funktionieren.
Auf der K 2025 wird die Rubberstreet wieder das Schaufenster für die Innovationsstärke und Leistungsfähigkeit der Elastomerbranche sein. Bereits seit 1983 ist sie ist die Anlaufstelle und Orientierungspunkt für alle, die sich über Elastomere (Kautschuk & TPE) auf der K informieren möchten. Schirmherr der Rubber Street ist der wdk (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie).
Über den Autor:
Der promovierte Chemiker Dr. Stefan Albus ist freiberuflicher Fachjournalist. Seine Schwerpunkthemen sind Polymerchemie sowie Kunststoff- und Gummi-Anwendungstechnik.
Über die K in Düsseldorf:
Im Jahr 1952 wurde die K erstmals von der Messe Düsseldorf veranstaltet und findet im Drei-Jahres-Turnus statt. Die letzte K im Jahr 2022 verzeichnete 3.020 Aussteller aus 59 Ländern auf über 177.000 m² netto Ausstellungsfläche und 177.486 Fachbesucher, davon 71 Prozent aus dem Ausland. Weitere Informationen unter www.k-online.de.
Bild: Credit: Constanze Tillmann /Messe Düsseldorf